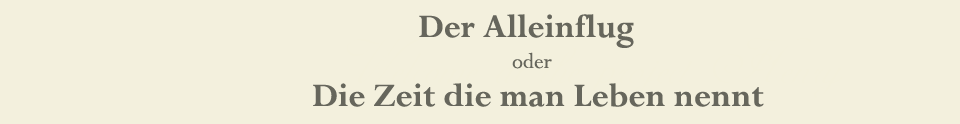3. Operation und die Entscheidung zwischen Leben und Tod
Jahr 2000 und 2001
Ein sonniger Tag begann, aber was interessierte mich das schon, es war Montag. Den letzten Abfall entsorgt und dann stand das Taxi auch schon vor der Tür. Ich habe in den 10 Jahren als Taxifahrer schon viele Menschen ins Krankenhaus gefahren, dass ich selbst einmal in diese Situation komme, wäre mir damals im Traum nicht eingefallen. Eine kurze Verabschiedung vom Kumpel und dann ließ ich die Vergangenheit hinter mir.
Ich war innerlich ruhig und meldete mich auf der Station 3.3 der Chirurgischen Klinik im Oskar – Ziethen – Krankenhaus. Mir wurde aber mitgeteilt, dass ich erst zur Anmeldung des Krankenhauses muss, um die Anmeldeformalitäten zu regeln. Als das geklärt war, ging ich zurück auf die Station und bekam mein Bett in einem Dreibettzimmer. In dem ein Bett besetzt war, aber dieser Herr ging am nächsten Tag auf eigenen Wunsch nach Hause. Ich wusste bis dahin gar nicht, dass es so etwas gibt. Ich blieb dann in diesem Zimmer allein bis zur Operation und hatte genug Zeit über mein Leben nachzudenken.
Das Krankenhaus in Lichtenberg ist noch in der Rekonstruktionsphase und deshalb auch nicht so modern eingerichtet. Es war ein Fernseher im Zimmer vorhanden, aber keine Toilette und kein Tisch zum Essen. Das Essen wurde auf dem Flur eingenommen. Mir war es die erste Woche egal, ich bekam sowie so nichts zu Essen. Ich fühlte mich fremd und einsam in diesem Krankenhaus, was aber, man sollte es nicht glauben, die nächsten Tage und Wochen verging. Es war für mich zeitweise zum zweiten zuhause geworden. Man lernte die Ärzte, Schwester und Mitpatienten kennen. Ich wollte zwar nicht für immer im Krankenhaus bleiben, aber es ließ sich aushalten.
Der erste Morgen war schon entsetzlich für mich, ich hatte wie ein kleines Kind ›das Bett voll‹ gemacht. Die Schwestern nahmen es gelassen überzogen es frisch. Dann bekam ich bis zur Operation, ›Pampers für Erwachsene‹ . Was es alles gibt, dachte ich. Dann gingen die Untersuchungen los, die waren natürlich nicht angenehm, da es sich immer um den Darm handelte. Sie zogen sich die ganze Woche hin, mehrere Darmspiegelungen, mit und ohne Kontrastmittel, mir wurden Sonden eingeführt, es wurde geröntgt und mehrere CTs durchgeführt. Ich habe es über mich ergehen lassen (müssen), andere Chancen hatte ich nicht und ich wurde regelrecht gleichgültig.
Am Freitag wurde mir mitgeteilt, dass ich am Montag operiert werden sollte. Die Diagnose hatte sich bestätigt. Bei mehreren Gesprächen wurde ich durch die Ärzte über die Operation aufgeklärt und vorbereitet, das letzte Gespräch fand am Freitag statt.
Bei den Gesprächen ging es im Prinzip darum, mir die drei Alternativen aufzuzeigen;
•• – die Erste war, es wird ein Stück vom Darm entfernt, dann wird er wieder zusammengenäht
und es ist alles o.k.
•• – die Zweite wie oben, nur es gibt einen künstlichen Darmausgang für einige Zeit oder für immer,
•• – die Dritte war, man kann nichts mehr machen und dafür gab es Anzeichen,
da der Tumor in der Nähe der Leber war.
Nun musste ich entscheiden ob ich die Operation überhaupt will, natürlich entschied ich mich für die Operation. Ein Grund dafür war, dass ich im Krankenhaus nicht das Gefühl hatte als Schwerkranker behandelt zu werden, deshalb habe ich versucht, den Gedanken an den Tod zu verdrängen, aber irgendwo nistet er sich eben doch im Hinterkopf ein.
Bis zu Operation habe ich mehrmals Besuch von meinen Verwandten bekommen, dass heißt von meiner Cousine, ihrem Sohn und von meinen Zwillingstanten, der letzte Besuch war am Sonnabend. Meine Frau habe ich angerufen und sie gebeten mich am Sonntag noch einmal zu besuchen, sie hat mir damals versprochen es zu versuchen, aber dabei blieb es. Ihre nebenberufliche Tätigkeit als Amway Berater schien ihr wohl wichtiger, ich existierte für sie gar nicht mehr.
An diesem Sonntag endeten für mich, die fast 10 Jahre Ehe, es ist mir klar geworden, sie hat sich endgültig entschieden, sie war für mich an diesem ›gestorben‹ . Oh, die Ohren klingen mir heut noch, als sie damals sagte, wir wollen so auseinander gehen, dass wir später noch einen Kaffee zusammen trinken können. Da bin ich gespannt, aber vielleicht erledigt sich das am nächsten Tag von selbst, daran habe ich ja noch gar nicht gedacht, denn beim Gericht war die Scheidung noch nicht eingereicht, dann bekommt sie gar noch die Witwenrente, das darf auf keinen Fall passieren, schon deshalb will ich überleben.
Am Sonntag musste ich noch einmal zum Röntgen, ein Arzt hatte festgestellt, dass noch eine Aufnahme fehlt. Am Abend habe ich meine Sachen in die Reisetasche verstaut und das Telefon abgemeldet. Da dieses, auch wenn man nicht telefoniert Geld kostete. Das Einpacken der Sachen in die Tasche war schon ein komisches Gefühl, so ungefähr wie ›Abfahrt ohne Wiederkehr‹ , denn die persönlichen Sachen werden im Abstellraum der Station deponiert und wenn man zurückkommt, gibt es die sie wieder, sonst bekommen sie die Angehörigen, praktisch oder?
Der nächste Tag begann wie immer, d.h. nichts zu essen, aber es stimmt nicht ganz, denn ich bekam eine Beruhigungstablette. Der Termin für die OP war für 11.00 Uhr festgelegt, das unendliche Warten begann, ich bekam mein ›Büßerhemd‹ und die weißen Kompressionsstrümpfe, ich sah richtig vornehm aus. Mir kam gleich das Sprichwort in den Sinn ›Vornehm geht die Welt zugrunde!‹ . Gegen 9.00 Uhr kam der Oberarzt, den ich bisher noch nicht gesehen hatte. Ein sehr netter, schon älterer Arzt, der mich nochmals über die Operation aufklärte. Seiner Ansicht nach würde ich 2–3 Tage auf der Intensiv Therapie Station (ITS) liegen und dann wieder in diese Abteilung zurückkommen. Er hat mir aufgrund seiner ruhigen Ausstrahlung doch sehr viel Vertrauen gegeben. Denn je näher der Termin kam, umso mehr war es mit meiner Ruhe vorbei. Es ist ja auch gelogen, wenn man sagt es lässt einem kalt, denn wenn es soweit ist dann hängt man doch am Leben.
Die Zeit verging es tat sich nichts, man wird mich doch nicht vergessen haben. Mir kamen Erinnerungen an meine Gallenoperation, da wurden bestimmte Stellen des Körpers schon einen Tag vorher von ›allen Haaren‹ befreit und man bekam noch einen Einlauf, obwohl im Darm hatte ich ja nix mehr. Ich wollte mich schon danach erkundigen, man will ja nichts falsch machen! Verspätet wurde ich in meinem Bett abgefahren, was zwei Krankenschwestern übernahmen. Das Gefühl mit dem Bett gefahren zu werden kann ich kaum beschreiben, es ist mit einem Karussell zu vergleichen. Es ging über Gänge und Fahrstühle, für die Schwestern war es nicht traurig, denn sie machten ihre Scherze, irgendwann kamen wir an. Ich wurde über einen ›Ladentisch‹ gereicht, auf eine nicht so weiche Pritsche umgebettet und es gab wieder was Neues zum Anziehen. Dann ging es in einen fensterlosen Raum und ich musste mich auf eine andere Pritsche setzen. Es waren vielleicht vier Leute um mich herum, aber ich war schon benommen, kann mich heut nicht mehr so richtig erinnern. Es war aber schon wichtig was hier geschah, man versuchte mir einen so genannten Schmerzkatheter ins Rückenmark zu legen, was nicht so richtig gelang. Ich kam mir vor, wie schon bei der Operation, ich blutete wie eine ›Sau‹ . Ich wurde noch einmal umgebettet, es war eine harte Wanne, dann bekam ich die Spritze in die Vene, ich hatte das Gefühl in ein tiefes, sehr tiefes schwarzes Loch rücklinks zu fallen und schwebte davon.
War es nur ein Traum oder hatte mich das Leben wieder. Noch konnte ich meine Umgebung nicht fassen, es war dunkel um mich herum. Aus weiter Entfernung drang eine Stimme an mein Ohr und sagte: »Es ist vorbei!«, aber was ist vorbei. War es das Leben oder die Operation? Es muss wohl die Operation gewesen sein. Noch im Unterbewusstsein bemerkte ich, dass sich jemand an mir zu schaffen machte, man hob mich oder schwebte ich immer noch. Ein Gesicht schaute mich nah an und wollte von mir wissen, wann wir mit der Physiotherapie beginnen wollen. Eine weitere Stimme sagte zu mir: »Den kenne ich doch!«. Dann wurde es wieder ruhig um mich, wahrscheinlich bin ich noch einmal eingeschlafen.
Als ich dann wieder aufwachte befand ich mich auf der Intensiv Therapie Station des OZK. Es war noch hell und die Sonne schien auf mein Bett, langsam kam ich nun zu mir. Es lag noch ein Patient im Raum, aber ich hatte den Fensterplatz. Ich habe mir nicht getraut mich zu bewegen und schaute erst einmal genauer um mich. Es war ein einziges Chaos, überall hingen Schläuche und Kabel( Mund, Nase, Körper, Harnröhre) von mir und es piepste unaufhörlich. Ich fühle ein Pflaster am Bauch, aber keine weiteren Wunden. Kein künstlicher Darmausgang? Nein es war keiner vorhanden, ich konnte es noch gar nicht fassen, die Tränen flossen in ›Strömen‹ . Dann erschien jemand an meinem Bett, es war die männliche Schwester Ralf, die mich fragte: »Wie geht es Ihnen, Herr Ullmann?«, anfänglich konnte ich nicht glauben, dass ich eine Operation hinter mir hatte. Ich war an Krebs operiert worden und lebte. Er versucht, so hatte ich den Eindruck mich durch ständige Fragen wach zu halten. Mehrmals kam die Ärztin und unterhielt sich mit mir, über meinen Job als Taxifahrer, später wurden mir auch schon ein Schlauch entfernt, die Magensonde, die Sauerstoffzufuhr behielt ich noch in der Nase. Während der Operation haben die Ärzte einen Katheter in die Vene gelegt, hier liefen mehrere Infusionen hinein, elektronisch gesteuert.
Anfänglich ging es mir den Umständen entsprechend gut, ich hatte keine Schmerzen. Man hatte mir immer wieder gesagt, wenn ich Schmerzen hätte sollte ich mich gleich bemerkbar machen. Dann fingen die Schmerzen trotz Schmerzkatheter gegen Abend an und waren nicht mehr unter Kontrolle zu bekommen. In der Nacht bekam ich mehrmals Morphium gespritzt, was aber nichts half, ein Arzt hat den Katheter am, bzw. im Rückenmark untersucht. Ich habe auch kaum schlafen können. Auf der Station ist schlafen sowieso nicht oder kaum möglich. Die Schwestern sind sehr besorgt und haben immer was am Patienten zu reparieren. Am nächsten Morgen wurde geklärt, wieso ich die Schmerzen nicht loswurde. Es stellte sich heraus, dass der Schmerzkatheter wahrscheinlich nicht richtig im Rückenmark saß und ich bekam ab sofort zusätzlich (man nannte es Bonus) eine Dosis Schmerzmittel durch einen der Schläuche. Ich war ja erstaunt, dass ich mich früh schon im Sitzen waschen musste, dazu wurden alle Kabel und Schläuche abgeklemmt und dann ging es los. Zu Essen gab es natürlich nichts. Nun hatte ich schon über eine Woche nichts Richtiges mehr zu Essen bekommen. Trotzdem, auch wenn es vielleicht durch meine Wirbelsäule nicht so richtig mit dem Schmerzkatheter geklappt hat, lasse ich auf das gesamte Team nichts kommen. Die Visite war zufrieden mit mir, da der schnelle Herzschlag zu hören war, beruhigte man mich. Der Oberarzt von meiner Station war auch dabei, was mir gut tat, denn endlich sah ich ein mir bekanntes Gesicht. Da ich sowieso ein sensibler Mensch bin, sind mir wieder paar Tränen über das Gesicht gerollt. Nach der Visite dachte ich, dass es etwas ruhiger wird aber es war eine Fehleinschätzung. Es kam die Therapeutin, alle Kabel und Schläuche wurden wieder abgeklemmt. Ich glaubte es kaum, als ich hörte, dass ich aufstehen und paar Schritte machen sollte. Es hat auch geklappt und Nachmittag das Gleiche noch einmal. Meine Cousine und Tante haben mich besucht, auch sie haben sich gefreut, dass es mir einigermaßen gut ging. Die Nacht verlief wieder unruhig, obwohl sich die Schmerzen im erträglichen Rahmen hielten. Als ich am Mittwoch aufwachte ahnte ich noch nicht, dass es mein letzter Tag auf der ITS werden sollte und es gab ein Problem, nicht so sehr für mich, sondern für die Schwestern. Ich hatte kein Rasierzeug von meiner Station mitgenommen, nur die Zahnbürste, die Schwestern wollten nur gepflegte Patienten auf der Station haben. Ich entwickelte mich doch noch zum Problemfall. Da sie mich nicht so liegen lassen wollte, hat man versucht mich mit einem, wahrscheinlich 50 Jahre alten, elektrischen Apparat, zu rasieren und letztendlich hat es auch einigermaßen geklappt, wer weiß was oder wer damit schon alles rasiert wurde.
Am Nachmittag musste ich mit meiner Therapeutin schon über den gesamten Flur laufen. Es hat mir sicherlich für den Heilungsverlauf gut getan, obwohl es genervt hat. Auf der Station wurde ich mit solcher Therapie in Ruhe gelassen, weil ich von mir aus, viel gelaufen bin. Ich merkte am späten Nachmittag eine gewisse Unruhe auf der Station, man sucht einen Patienten der schon auf die ›normale‹ Station verlegt werden könnte. Für mich eigentlich ein gutes Zeichen, denn man hatte mich ausgewählt. Nun ging es mir bald zu schnell. Der Herr Professor war noch einmal an meinem Bett und sagte mir: »Später hätten sie nicht kommen dürfen, Herr Ullmann, dann wäre es mit Sicherheit vorbei gewesen!« Da fingen die salzigen Tropfen gleich wieder an zu laufen, ehrlich sind die Ärzte hier.
Danach war Eile geboten, ich konnte gerade noch sagen, dass mich meine Tante besuchen kommt und sie möchten ihr mitteilen, wo ich bin, weil sie nicht gut sieht. In meiner Station kam ich auf ein anderes Zimmer, ein Zweibettzimmer, ein Bett war schon belegt und meine gepackte Reisetasche bekam ich auch zurück. Nun lag ich da mit meinen Schläuchen und Tröpfen. Der ältere Herr hat mich herzlich empfangen und wie es so üblich ist wurden die Krankengeschichten ausgetauscht. Irgendwie kommt man zurück in eine fremde, andere Welt und fühlt sich unbeholfen.
Auf der ITS hat eine Schwester zwei Patienten zu betreuen und hier zwei Schwestern 20 Patienten. Zum Glück kam meine Tante zu Besuch und hat mir meine Sachen in den Schrank eingeräumt. Die Nacht verlief besser als ich dachte, ich bekam schon einen kleinen Schluck zu trinken, aber nix zu essen. Schon in der ersten Nacht hatte ich den Eindruck, ich bin wieder umsorgt, die Nachtschwester kam mehrmals zu mir, um sich um mich zu kümmern. Ich hing aber immer noch an meinen Schläuchen, ein permanenter Brechreiz überkam mich. Ich hatte panische Angst davor, nach einer frischen Operation einen Hustenanfall zu bekommen und jetzt war es bald soweit. Mir kam sofort der Gedanke, dass ich ja seit der OP noch keine Tablette gegen den Diabetes eingenommen hatte. Ich klingelte nach der Schwester, es wurde sofort der Zuckerwert gemessen, der aber relativ normal war.
Meine Cousine kam mich am Vormittag besuchen und hat das Telefon wieder aktiviert, denn ich musste mich ja bei meiner Familie zurückmelden. Aber sie merkte bald, dass ich Probleme hatte. Ein Arzt war nicht zu sprechen, alle waren sie im Operationssaal, aber nachmittags hat man mir die Tröpfe vorläufig abgenommen und der Brechreiz war weg. Bis dahin habe ich schreckliche Stunden erlebt. Die Visite am Abend ergab dann zu meiner Freude, dass ich auch nicht wieder angeschlossen werde, gegen den Brechreiz bekam ich ein Medikament. Am nächsten Tag (Freitag) gab es schon eine Suppe zu den Mahlzeiten und der Blasenkatheter wurde ebenfalls entfernt. So langsam kam alles heraus was nicht zu mir gehörte.
In den Vormittagsstunden erschien eine Mitarbeiterin des Sozialdienstes bei mir, bis dahin hatte ich keine Zeit, mich mit dem Leben nach dem Krebs zu beschäftigen. Eine nette, einfühlsame Frau stand vor meinem Bett. Es ging um solche Fragen wie; Beantragung der Schwerbehinderung nach Krebsoperation, Beantragung einer Reha (ich hatte noch nie eine Kur) und Betreuung durch die Krebshilfe des Bezirksamtes. Es war für mich ein, sehr aufschlussreiches, Mut machendes Gespräch aber dann kam mir wieder die Gedanken der Existenzangst. Ein schwerbehinderter, selbstständiger Taxifahrer wie soll das funktionieren! Allerdings wusste ich auch, dass es erst einmal Krankengeld für noch fast 1 1/2 Jahre gibt und das war mehr als ich beim Taxifahren verdiente. Also, erst einmal ruhig bleiben war die Devise und wer es kann ist fein raus.
Sonnabend kamen meine Tanten und Cousine zu Besuch, aber so richtig gut ging es mir immer noch nicht, sie haben es wohl auch gemerkt und machten deshalb nur einen kurzen Besuch. Sonntag, es ging mir wesentlich besser, ich durfte Duschen und das Pflaster auf der Operationsnarbe wurde entfernt. Nach so kurzer Zeit und Wasser, da habe ich schon andere Erfahrungen gemacht. Na ja es waren eben die neuen Methoden, wahrscheinlich gute, denn ich habe keine Probleme mit meiner Narbe, Fäden mussten auch nicht gezogen werden.
Ich hatte allen Grund zur Freuden, meine Eltern, Schwestern und mein Schwager kamen am Sonntag zu Besuch. Da ich schon viel trainiert hatte, konnte ich sie im Hof empfangen und wir gingen gemeinsam in die Cafeteria. An ihren erstaunten Gesichtern konnte ablesen, dass sie eher dachten einen bettlägerischen, todkranken Menschen vorzufinden. Eine wirklich gelungene Überraschung, dafür war ich meiner Familie sehr dankbar, denn Bautzen liegt ja nicht gerade um die Ecke.
Ja, ich fühlte mich wie schon oben erwähnt ziemlich zuhause im Krankenhaus. Als man mir aber am Montag sagte, dass ich erst in der nächste Woche entlassen werde, konnte ich gar nicht begreife warum. Da aber sowieso niemand auf mich gewartet hat, nahm ich es zu Kenntnis, aber ich wollte unbedingt Vollkost haben und ich war froh, dass keiner nach der Diabetes gefragt hat. Ich hatte einen vorher nicht gekannten Appetit auf reichliches Essen, was sicherlich kein schlechtes Zeichen ist. Es gab eine schlimme Krankheit, die ich überstand und deshalb verdiente ich die Vollkost. Fast 2 Wochen nichts Richtiges zu essen, deshalb mahnte ich bei der Visite am Nachmittag selbige an und bekam sie auch. Als ich zum Abendbrot meine Vollkost betrachtete, habe ich mich, wie Weihnachten gefreut und aß Sachen, die ich unter normalen Umständen nie und nimmer gegessen hätte,(Schmelzkäse, Blutwurst, und vieles andere mehr), es gab sogar noch Nachschlag von den Schwestern und was meine Zimmerkollege nicht wollte, aß ich auch noch, ich freute mich auf jede Mahlzeit.
Ich kann es immer noch nicht richtig begreifen, dass ich die Operation überstanden habe, denn die Statistik beschreibt ein nicht so gutes Bild. Oder war ich einer von den jährlich 30.000 ›Darmkrebsen‹ die es überstanden haben. Das war dann doch fast wie ein Lottogewinn und über einen Gewinn freut man sich. Aber mit wem sollte ich die Freude teilen, wer war da, es gab nur meinen engerer Familienkreis, ja die waren immer für mich da, dass ist ein Markenzeichen der Familie Ullmann. Da es nicht überall so ist, erfüllt mich das mit Stolz.
Die anderen ›Freunde‹ und so genannten Bekannten, wo waren sie? Von den 40 Leuten die meinen Geburtstag ausgelassen gefeiert haben, wird sich später mal keiner rausreden können und da gibt es einige von denen ich es nicht erwartet hätte, vielleicht kommen später noch welche zur Besinnung, vielleicht tue ich auch den Menschen Unrecht, da ich nicht weiß was meine ›zukünftige Ex – Frau‹ alles über mich erzählt hat. Im Schlechtmachen war sie Meister und konnte das auch glaubwürdig rüberbringen.
Mein Nochschwager hat mich als einziger im Krankenhaus besucht, da habe ich in der Cafeteria probiert, ob das Bier noch schmeckt, ja es schmeckte noch, so gut, dass ich mir eine Flasche mitnahm und im stationseigenen Kühlschrank deponierte. In der letzten Woche im Krankenhaus ging ich viel spazieren und machte mir über mein bisheriges und zukünftiges Leben viele Gedanken.
Wenn man alleine ist kommen einem schon die ausgefallensten Ideen und mir kam in den Sinn, Vögel zu halten. Diesen Gedanken hatte ich eigentlich schon vor meiner Krankheit, da von meinem Wohnzimmer ein kleines Zimmer abging, kaum zu nutzen für irgendwelche Zwecke.
Bei der Visite, am Nachmittag wurde mir mitgeteilt, auf der Station war immer früh und nachmittags Visite, dass ich am Mittwoch nächster Woche entlassen werde, aber da ein Lymphknoten ›etwas abbekommen‹ hat, muss ich mich einer Chemotherapie unterziehen, dass auch noch eine Bestrahlung erfolgt, wurde mir vorerst nicht gesagt.
Immer hatte ich in Verbindung mit Krebs von Chemotherapie bzw. Strahlentherapie gehört, aber so richtig habe ich mich damals nicht dafür interessiert, ja es betraf mich ja nicht und nun hatte ich diese Therapien selbst am Hals, so schnell geht es manchmal.
Gleich kamen mir die Menschen im Sinn die ich, mit dem Taxi zu solchen Therapien gefahren habe, also auch mir bleibt es nicht erspart. Ich dachte aber sei froh, dass du lebst und jammere nicht. Also, ein Lymphknoten von 30, sagt der Doktor, dann habe ich ja Glück, oder! Trotzdem war mein Optimismus etwas gedämpft worden, doch keine Zebrafinken?
Man sagte mir auch, dass das Probleme mit dem Stuhlgang immer wieder auftreten können, vor allem Durchfall, was aber normal wäre. Der Tumor war zwar nur knapp 8 cm groß, aber es wurden ca. 25 cm vom Darm entfernt.
Es verlief bis zur Entlassung alles gut. Die Sozialarbeiterin des Krankenhauses hat noch den Antrag auf Schwerbehinderung eingereicht, bei der Reha – Maßnahme, haben wir uns geeinigt, diese nach der Chemotherapie zu beantragen. Am Mittwoch war es dann soweit, ich konnte nachhause gehen, nun hat es doch über drei Wochen gedauert, zuvor musste ich noch bei der Onkologin vorbei und den Arztbrief,
Chirurgische Klinik Berlin, den 25.07.2000
Allgemein–und Visceralchirurgie
Chefarzt: Prof.Dr.med.K.Gellert
Station : 3.3. Ullmann, Henry, geb. am 27.12.1948. Schwalbenweg 37, 12526 Berlin
Stationär vom 03.07. bis 25.07.2000
Diagnose: Adeno–Karzinom des rektosigmoidalen Überganges
Diabetes mellitus (tablettenpflichtig)
Z.n. Nephrolithiasis
Therapie: Anteriore Rektumresektion, Rekonstruktion mittels Descendorektostomie am 10.07.2000
Histologie: Ca. 70 mm mess., nach Ang. im Rektosigmoid lokalisiertes, mäßig diff., tubuläres Adeno – Karzinom mit breiter Infiltration des paracolischen Fettgewebes, Angiosis carcinomatosa. In einem von 32 Lymphknoten des paracolischen Fettgewebes eine Metastasierung. Ein kleines tubuläres Dickdarmadenom mit bis mäßiggradigen Epitheldysplasien. Die Resektionsränder des Darmpräparates tumorfrei.
Im Rahmen der praeoperativen Vorbereitung führten wir am 04.07.2000 eine kontrastmittelverstärkte Abdomen–Computertomographie mit dem Nachweis einer hochgradig malignomsuspekten Wandverdickung des Sigma bzw. Rektosigmoids durch. Hierbei war eine Infiltration der Harnblase nicht auszuschließen. Ferner erfolgte der Nachweis grenzwertig großer Lymphknoten lateral der Aorta cranial der Bifurkation.
Die am 07.07.2000 durchgeführte retrograde Colondarstellung im Doppelkontrast ergab malignomtypische Raumforderung im rektosigmoidalen Übergang, Sigmadivertikulose. Das übrige Colon ohne Hinweis auf einen stenosierenden Prozess.
Am 10.07.2000 erfolgten die anteriore Rektumresektion sowie die Rekonstruktion mittels Descendorektostomie. Der postoperative Verlauf gestaltete sich ohne Komplikationen.
Im Rahmen des histologischen Staging ergab sich die Indikation zu einer adjuvanten Chemotherapie. Herr Ullmann wurde über die Notwendigkeit dieser Therapie sowie die Möglichkeit, diese bei Frau Dr.med. Zippel in der Chirurgischen Poliklinik am Hause durchzuführen, aufgeklärt.
Wir entlassen Herrn Ullmann am 25.07.2000 mit primär verheilten OP–Wunden, termingerecht gezogener Wunddrainage, gut toleriertem oralen Kostaufbau, regelrechter Stuhlgangsfunktion sowie in subjektivem Wohlbefinden in die weitere ambulante Betreuung.
Laborwerte (SI – Einheiten) : bei Entlassung alle Werte im Normbereich
Medikation : Antra 20 1 – 0 – 1
Mit freundlichen Grüßen
Prof. Dr. med. K. Gellert Chefarzt
Dr.med H. Gran Oberarzt
St.Eggeling Facharzt für Chirurgie
abgeben, erhielt meinen ersten Termin, danach ging es mit dem Krankentransport nachhause, ein ganz eigenartiges, erhebendes Gefühl durchströmte mich. Irgendwie war mir warm ums Herz und man sieht die Welt tatsächlich mit ganz anderen Augen.
Ich glaube, ich sah in dieser Zeit zum ersten Mal das Abendrot an meinem ›Lebenshorizont‹ ganz deutlich vor mir. Seine Farben lassen sich leichter deuten, wenn man die Augen reichzeitig für die Gezeiten des Lebens schult. Zum Glück erstrahlte nun das Morgenrot wieder auf.
In meiner Wohnung angekommen, mein Kühlschrank war gefüllt worden von den guten Geistern, meiner Cousine und ihrem Sohn, die auch noch am selben Tag nach dem Rechten sahen, trotzdem fühlte ich mich in der Wohnung einsam. Von meiner Krankheit, ich konnte es gar nicht glauben, spürte ich kaum etwas, ich hatte Appetit auf alles, auch auf Bier und Zigaretten. Im Krankenhaus rauchte ich natürlich nicht. Ich probierte es erst einmal mit einer Pfeife, na ja! Dann war baden angesagt, denn die sanitären Einrichtungen im Krankenhaus waren zwar in Ordnung, aber es gab für alle männlichen Patienten nur eine Toilette, mit Dusche, man konnte die Dusche benutzen oder die Toilette. Die baulichen Voraussetzungen gaben eben nichts anderes her. Aber wenn alles andere stimmt ist es schon o.k. so. In den rekonstruierten Teilen des Oskar Ziethen Krankenhaus sind Toiletten und Duschen auf den Zimmern. Damals konnte ich auch noch nicht ahnen, dass mir das Baden bald nicht mehr soviel Freuden bereiten würde, ich habe immer gern und ausdauernd gebadet.
Mein erster Termin bei der Onkologin in der Poliklinik des Krankenhauses gab mir wieder Mut, mit zitternden Knien bin ich hingegangen. Der Therapieplan sah vor, dass ich vier Staffeln Chemotherapie bekomme, nach den ersten beiden Staffel sollte ich zur Bestrahlung, wahlweise entweder in die Charité in Berlin Mitte, oder nach Berlin – Buch gehen. Zur Beruhigung sagte sie mir, dass es nicht so eine ›scharfe‹ Chemotherapie wäre, die in der Regel gut vertragen wird. Die Ärztin, ca. 35 Jahre alt machte auf mich einen zuverlässigen, sympathischen Eindruck und stand mit den Ärzten der chirurgischen Station des OZK in Verbindung. Heute bekam ich noch keine Therapie, sie gab mir noch eine Woche Zeit, die ich in Bautzen bei meinen Eltern und Geschwistern verbrachte. Die Freude war mich wieder zu sehen. Aber auch hier gab es zwar im engsten Familienkreis kleine Berührungsängste im Umgang mit einem Krebskranken, aber man merkte doch eine gewisse Zurückhaltung und Unsicherheit, also man wird z.B. nicht direkt gefragt: »Hallo, wie geht es dir?«, sondern schon etwas vorsichtiger. Nach der Krankheit oder Operation fragt man überhaupt nicht.